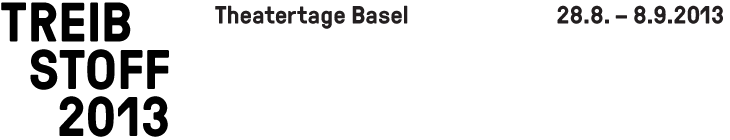Kritik zu «Conan der Zerstörer» von SKART
Viva la muerte – Es lebe der Tod
Von Nick-Julian Lehmann
Bereits den Erzählungsvorlagen von Robert E. Howard um 1932 sowie der Conan-Filmreihe der 1980er Jahre wurden menschenverachtende und faschistoide Züge vorgeworfen. «Schröppel Karau Art Repetition Technologies» haben diesen Vorwurf zum Ausgangspunkt ihrer Arbeit gemacht und sind Conan als Geschwür des Kapitalismus angegangen.
Auf Einladung der Treibstoff Theatertage 2013 entstand in der Reithalle der Kaserne Basel eine Tour-de-Force aus agitatorischem Trash-Talk, affig-witzigen Tanzeinlagen und karikierend heuchlerischer Therapiesitzung. Doch neben den handwerklich und ästhetisch überzeugenden Videoprojektionen und dem Sounddesign wirkt der Abend darstellerisch eigenartig unausgegoren: zu lang, zu eintönig werden Textmassen zur Faschismustheorie, Warenästhetik und Körperkult vorgetragen. Zu ungebrochen werden die Showeinlagen der beiden Entertainer als faschistische Wortführer dargeboten. Dadurch entsteht eine sinnentleerende Hülse, in der eine Performance kreist, die mittels ihrer zynischen Kraft eine faschistoide Form zu reproduzieren scheint. Darin, dass sie durch übertriebene Publikumsansprachen und Dada-Einlagen in bloßen Ästhetizismus abzudriften droht, liegt möglicherweise ihre tatsächliche Sprengkraft. Diese Sprengkraft beruht allerdings nicht auf einer theatralen Auseinandersetzung, sondern auf der von SKART angerissenen Kulturkritik, in der Conan als Paradigma der Selbstoptimierung vorgeschlagen wird. Demnach scheint SKART all diejenigen als Conan begreifen zu wollen, die sich inmitten der Auswirkungen des aktuellen Finanzsystems, bei zunehmend verheißungs-loserer Zukunft mit Ratgeberliteratur wappnen. Conan als Jemand der von Ego-Coaches, Fitnesstrainern, Entertainern und anderen Supervisoren befragt, therapiert und ausgerichtet werden möchte: «Conan, wie geht es Dir?» – «Conan, Du hast nach Liebe gesucht, wie ist es Dir ergangen?» – «Conan, sind schöne Menschen mehr Wert als hässliche?» - «Conan, steht für Dich die Gemeinschaft über dem Wohl des Einzelnen?». Seine Antworten fallen naiv und knapp aus. Den Entertainern scheint es recht zu sein, wirken sie doch wie Repräsentanten einer durchrationalisierten Zweckgesellschaft, in der jeder sich an einem Idealtypus ausrichtet.
Währenddessen sitzt Conan, in einer gewieften Crossgender-Besetzung, zumeist tatenlos in einem aus Plastikstühlen konstruierten Altar und lässt sich davon berieseln, wie er als zutiefst ängstlicher Kontrollfreak entlarvt wird. Er zieht die schnelle Gewissheit, Antwort und Sicherheit einer zähen differen-zierten Auseinandersetzung vor. Doch gerade in der Veranschaulichung dieser Kritik liegt die mögliche Krux für die Verstocktheit des Publikums an diesem Abend: Indem die zur Karikatur verzerrten Entertainer fortwährend auf das Publikum einsprechen - während sie eigentlich Conan adressieren - setzen sie die Masse des Publikums mit dem Faschisten in Beziehung. Es entsteht etwas für das Theater Beklemmendes: Conan als Zuschauer gedacht, erscheint plötzlich als jemand, der in Angstattacken gefangen zum Entertainment greifen muss, um sich zumindest für ein paar Stunden abzulenken. Anders herum werden die Performer zu solchen, die alles dafür tun, noch einmal gut aussehend vor Publikum und Feind strahlend dastehen zu dürfen.
Eine beklemmende Zwickmühle, die die beiden Performer Mark Schröppel und Phillip Karau noch zuspitzen, indem sie zu keinem Zeitpunkt ernsthafte Anstalten machen, aus ihrer Entertainer-Rolle auszusteigen. Ein zunehmend angespanntes Verhältnis zwischen Bühnen- und Zuschauerraum ist die Folge. Die große Enttäuschung des Abends besteht nicht etwa in SKARTs theore-tischem Ansatz, der wirklich produktives Anküpfungspotenzial böte, sondern in der sperrigen Dramaturgie, die dem Publikum nur äußerst selten einen Einstieg ermöglicht. Die angekündigte Auseinandersetzung mit Desorientierung, Kapitalismus und Aufbegehren ist SKART dennoch gelungen, weil die Performance bei großen Teilen des Publikums Reaktionen hervor gerufen hat, die eben diese Dynamiken entlarven. Besonders auffällig wurde dies in den partizipatorischen Einlagen: So landeten einige der Tennisbälle statt auf dem befohlenen Turm aus roten Plastikeimern auf den Performern selbst. Ein Tennisball wird zum subversiven Moment, der ein wenig Spaß verspricht, schließlich wurde dafür ja auch bezahlt. Desorientierung im Kapitalismus eben.