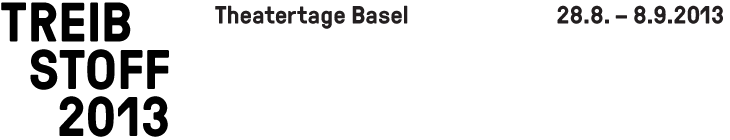Kritik zu «Fort Yuma» von Fries/Schäfer
Wer zuletzt lacht
Von Oliver Roth
Das Stück "Fort Yuma" nimmt das Verhältnis zwischen der Schweiz und Deutschland unter die Lupe. Auf der Bühne entsteht eine Dokumentation, die über sich selbst nachdenkt und vor allem auf eines setzt: viel Witz.
Mit dem Humor ist es so eine Sache. Jede und jeder findet andere Dinge witzig. Einige finden es verfehlt im Zusammenhang mit dem Holocaust zu lachen. Andere sind sich auch für rassistische Witze nicht zu schade. Ein Zitat von Peer Steinbrück (ob nun lustig gemeint oder nicht) bietet den Ausgangs-punkt für das dokumentarische Feldforschungs-Stück von Fries/Schäfer: Steinbrück erklärt in seinem Ausspruch die Schweizer zu Indianern und die Deutschen zu Soldaten. So begab sich die Theatergruppe in die Prärie, um den Deutsch-Schweizerischen Verhältnissen und Konflikten nachzufühlen. Die Forschungsergebnisse werden auf der Bühne zu einem Doku-Film montiert. "Alles was sie hüt gsänd, isch eso passiert": Szenen aus dem Schwiizerdütsch-Unterricht an der Migros Clubschule wechseln sich mit Erfahrungen einer Deutschen-Exil-Familie, politischen Reden und Klischees ab. Und dabei wird eben vor allem auf Humor gesetzt. Zum Beispiel mal plump, als Peer Steinbrück als schreiender amerikanischer Bürgerkriegssoldat auftritt. Oder mal absurd, als der Schweizer Schrägstrich Indianer seiner Stammesmutter beichtet, er habe sich in eine "white woman" Schrägstrich Deutsche verliebt. Ein Fondue steht während der ganzen Inszenierung am Bühnenrand und verteilt seinen käsigen Duft im Raum. Viele Szenen leben von Situationskomik, vom Spiel mit Klischees, von absurden Momenten. Eine solche Darstellungsweise bietet Raum zur Reflexion. Etwa als sich die Schauspieler auf der Bühne die Frage stellen, wie dramatisch die interviewte deutsche Mutter nun darzustellen sei. Reflexion über das eigene Reenactment, über Darstellung, über die Fiktionalität und Inszenierung von Dokumentationen wird möglich.
Eine Szene verdeutlicht dies besonders anschaulich: Zwei Deutsche erzählen in einem abgedunkelten Raum wie sie in der Schweiz bedroht wurden. Sie berichten von Drohbriefen, die sie erhalten haben, wie sie Angst litten, gar um ihr Leben bangten. Durch die Darstellungsweise muss man aber unweigerlich lachen. Die verzerrte Synchronstimme, die typische Aufmachung der Opfer mit wasserstoffblonder Perücke und Baseballcap und die übertriebenen Gesten der Schauspieler karikieren den Reportage-Duktus von Fernsehformaten wie Spiegel TV Reportage auf RTL oder Pro Sieben. Die Botschaft ist aber keines-falls lustig: Gegen Menschen wurden aufgrund ihrer Nationalität Morddrohungen ausgesprochen. Das Lachen bleibt einem im Hals stecken. Ein starker Moment.
Die Schauspieler kommen am Ende zu einem eigenen Fazit: Sie haben sich mehr erhofft von ihren Nachforschungen - die Dramatik des Konflikts fanden sie nicht. Eigentlich schön. Aber wurde die scharfe Deutsch-Feindlichkeit wie sie von Wochenblättern am politisch rechten Rand und von Spitzenpolitikern salonfähig geführt wurde, und noch immer geführt wird, auch für Unwissende kritisch dargestellt? Reicht Humor (wenn er denn als solcher wahrgenommen wird) gegen Ausländerfeindlichkeit? Für jene, die sich seit Jahren von rechten Parolen überschüttet sehen und die Debatte um "die Deutschen in der Schweiz" kennen, bot das Stück keine neuen Themen, aber immerhin viel zu lachen.